Faire Neuordung
statt Krieg
Eine Trennung ist emotional. Das Recht darf es nicht sein. Ich sorge für Struktur in einer aufgewühlten Zeit – mit klarem Blick auf Ihre Ansprüche, Ihre Zukunft und die rechtlichen Wege dorthin. Ob einvernehmlich oder streitig, mit Kindern oder Ohne: Ich vertrete Sie mit Nachdruck und Weitblick. Denn wer loslässt, braucht Halt. Juristisch und Menschlich.
Zwei Unterschriften, ein Neuanfang. Ich sorge für klare Verträge – leise, schnell und ohne Nebengeräusche.
Wenn der Konflikt vorprogrammiert ist, braucht es Strategie. Ich verteidige Ihre Position – ruhig, präzise, durchsetzungsstark.
Kinder brauchen Stabilität. Ich gestalte Regelungen zu Obsorge und Kontaktrecht, die halten – auch, wenn es schwierig wird.
Was bleibt? Wer zahlt? Wer geht? Ich ordne, wer wofür haftet – und schütze, was Ihnen zusteht.
Wenn aus Liebe ein Verfahren wird
Manchmal ist der Bruch unumkehrbar. Dann geht es nicht mehr um Versöhnung, sondern um Gerechtigkeit. Ich begleite Sie durch die streitige Scheidung mit juristischer Klarheit und menschlichem Verständnis. Ich höre zu, filtere das Wesentliche – und vertrete Ihre Interessen mit Nachdruck. Denn wer sich trennt, braucht nicht nur Schutz. Sondern jemanden, der bereit ist, für ihn einzustehen. Bis zum Schluss.

„Eine Scheidung sollte kein Krieg sein – sondern eine faire Neuordnung.“

Dein Kind braucht Klarheit
Wenn Eltern sich trennen, stehen drei Fragen im Raum: Wer bekommt die Obsorge? Wer zahlt Unterhalt? Und wie läuft der Kontakt? Ich beantworte diese Fragen nicht theoretisch, sondern konkret. Ich entwickle Lösungen, die dem Kind Stabilität geben – und beiden Eltern rechtlich klare Wege aufzeigen.
Konkret in einer schwierigen Zeit
Eine einvernehmliche Scheidung in Österreich erfolgt im Außerstreitverfahren gemäß §§ 94 ff AußStrG Hackl, Einvernehmliche Scheidung (Stand 24.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at). Der Ablauf umfasst folgende Schritte:
Voraussetzungen:
Die eheliche Lebensgemeinschaft muss seit mindestens einem halben Jahr aufgehoben sein (§ 55a Abs. 1 EheG) § 55a EheG.
Beide Ehegatten müssen die unheilbare Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses zugestehen (§ 55a Abs. 1 EheG) § 55a EheG.
Es muss Einvernehmen über die Scheidung bestehen (§ 55a Abs. 1 EheG) § 55a EheG.
Eine schriftliche Vereinbarung über die Scheidungsfolgen ist erforderlich. Diese umfasst die Betreuung und Obsorge der gemeinsamen Kinder, das Recht auf persönliche Kontakte, Unterhaltspflichten sowie vermögensrechtliche Ansprüche (§ 55a Abs. 2 EheG) § 55a EheG, Weinrich, Scheidungsfolgen – Allgemein (Stand 26.2.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Antragstellung:
Die Ehegatten stellen gemeinsam einen Antrag auf Ehescheidung beim zuständigen Bezirksgericht (§ 55a Abs. 1 EheG) § 55a EheG.
Es ist möglich, vorab mit dem Richter einen Termin zu vereinbaren und diesem die Scheidungsfolgenvereinbarung sowie notwendige Dokumente zu übermitteln Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Ehescheidungsverfahren.
Beratungspflichten:
Bei minderjährigen Kindern müssen die Ehegatten nachweisen, dass sie sich über die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kinder beraten lassen (§ 95 Abs. 1a AußStrG) § 95 AußStrG.
Das Gericht weist auf mögliche Nachteile hin, wenn eine Partei nicht anwaltlich vertreten ist oder keine Beratung zu den Scheidungsfolgen in Anspruch genommen hat (§ 95 Abs. 1 AußStrG) § 95 AußStrG.
Verhandlung und Abschluss:
Die mündliche Verhandlung ist verpflichtend (§ 94 Abs. 1 AußStrG) § 94 AußStrG.
Der Scheidungsbeschluss wird verkündet, ist jedoch erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig (§ 94 Abs. 3 AußStrG) § 94 AußStrG, OGH 4Ob543/92 (RS0057115).
Rechtskraft und Abschluss:
Die Ehe wird durch Zustellung der Beschlussausfertigungen beendet, sofern kein Rechtsmittel eingelegt wird (§ 94 Abs. 3 AußStrG) § 94 AußStrG, OGH 4Ob543/92 (RS0057115).
Wenn ein Ehegatte durch die Scheidung den Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung verliert, informiert das Gericht den zuständigen Krankenversicherungsträger (§ 95 Abs. 3 AußStrG) § 95 AußStrG.
Die genannten Schritte und Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, damit die Scheidung durchgeführt werden kann Hackl, Einvernehmliche Scheidung (Stand 24.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at), Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Ehescheidungsverfahren.
Eine Scheidung wird in Österreich streitig, wenn die Ehegatten sich nicht auf eine einvernehmliche Scheidung gemäß § 55a EheG einigen können und stattdessen eine der folgenden streitigen Scheidungsarten geltend gemacht wird:
Scheidung wegen Verschuldens (§ 49 EheG):
Ein Ehegatte kann die Scheidung begehren, wenn der andere durch eine schwere Eheverfehlung oder durch ehrloses oder unsittliches Verhalten die Ehe schuldhaft so tief zerrüttet hat, dass die Wiederherstellung einer ihrem Wesen entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht erwartet werden kann. Beispiele für schwere Eheverfehlungen sind Ehebruch, körperliche Gewalt oder schweres seelisches Leid § 49 EheG, Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Ehescheidungsverfahren.
Scheidung aus anderen Gründen (§§ 50 und 52 EheG):
Die Scheidung kann auch beantragt werden, wenn die Zerrüttung der Ehe auf einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung beruht (§ 50 EheG) oder wenn ein Ehegatte an einer schweren ansteckenden oder ekelerregenden Krankheit leidet (§ 52 EheG) § 50 EheG, § 52 EheG.
Scheidung wegen Auflösung der häuslichen Gemeinschaft (§ 55 EheG):
Wenn die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit drei Jahren aufgehoben ist und eine tiefgreifende unheilbare Zerrüttung der Ehe vorliegt, kann die Scheidung beantragt werden. Das Gericht kann die Scheidung jedoch verweigern, wenn die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft zu erwarten ist oder wenn die Zerrüttung überwiegend vom klagenden Ehegatten verschuldet wurde und die Scheidung den beklagten Ehegatten härter träfe § 55 EheG.
Die streitige Scheidung wird durch gerichtliche Entscheidung durchgeführt (§ 46 EheG) § 46 EheG. Dabei besteht Anwaltspflicht gemäß § 93 Abs 1 AußStrG Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Ehescheidungsverfahren.
Die Kosten einer Scheidung in Österreich setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen:
Gerichtskosten:
Für ein Scheidungsverfahren nach § 55a Ehegesetz (einvernehmliche Scheidung) beträgt die Pauschalgebühr 293 Euro gemäß Tarifpost 12 lit a Z 2 des Gerichtsgebührengesetzes (GGG) BVwG 03.05.2019, G314 2209903/10001.
Für das Verfahren in zweiter Instanz beträgt die Pauschalgebühr 310 Euro gemäß Anmerkung 6 zu Tarifpost 2 GGG OGH 30.07.2013, 2 Ob 107/13v.
Anwaltskosten:
In Scheidungsverfahren besteht keine absolute Anwaltspflicht (§ 27 Abs. 2 ZPO iVm § 49 Abs. 2 Z 2a JN) VwGH 15 Ra 0112/2021 = ÖStZB 2022/168 (Bleyer), Rechtsanwaltskosten als außergewöhnliche Belastung iZm einem Scheidungsverfahren (26.09.2022, LexisNexis Rechtsnews 33078 in lexis360.at), VwGH 15 Ra 0112/2021 = ARD 6809/14/2022 (Bleyer).
Jeder Ehegatte trägt die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen Vertretung selbst BFG 02.05.2018, RV 7102574/2015.
Kostentragung bei Verschuldensausspruch:
Wird die Ehe nach § 55 Ehegesetz geschieden und enthält das Scheidungsurteil einen Ausspruch über das Verschulden, so hat der schuldige Ehegatte die Kosten des anderen Ehegatten zu ersetzen (§ 45a Abs. 2 ZPO) § 45a ZPO.
Die Dauer eines Scheidungsverfahrens in Österreich hängt von der Art der Scheidung ab:
Einvernehmliche Scheidung:
Eine einvernehmliche Scheidung erfolgt im Außerstreitverfahren gemäß §§ 94 ff AußStrG. Die Voraussetzungen umfassen unter anderem die mindestens sechsmonatige Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft, das Zugeständnis der unheilbaren Zerrüttung und eine schriftliche Scheidungsfolgenvereinbarung. Nach Einreichung des Antrags und Erfüllung der Voraussetzungen kann die Sachentscheidung durch Beschluss erfolgen. Verzichten die Ehegatten nicht auf Rechtsmittel, kann der Antrag bis 14 Tage nach Zustellung des Protokolls und des Beschlusses zurückgezogen werden. Die Ehe wird erst durch Zustellung der Beschlussausfertigungen beendet Hackl, Einvernehmliche Scheidung (Stand 24.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at), Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Ehescheidungsverfahren.
Streitige Scheidung:
Die Dauer eines streitigen Scheidungsverfahrens kann erheblich variieren, abhängig von der Komplexität des Falles und den Streitpunkten zwischen den Parteien. Laut einer Fallstudie können solche Verfahren in einigen Fällen bis zu fünf Jahre dauern, insbesondere wenn keine Einigung erzielt wird und umfangreiche rechtliche Auseinandersetzungen erforderlich sind BVwG 01.03.2024, L530 1414212/10003.
Die rechtlichen Grundlagen für die einvernehmliche Scheidung sind in § 55a EheG geregelt, während die streitige Scheidung nach § 49 EheG erfolgt Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Ehescheidungsverfahren.
Im Falle einer Ehescheidung wird das eheliche Gebrauchsvermögen, zu dem auch die Ehewohnung zählt, gemäß § 81 Abs. 1 EheG unter den Ehegatten aufgeteilt. Dabei werden auch Schulden berücksichtigt, die mit dem Gebrauchsvermögen in einem inneren Zusammenhang stehen § 81 EheG.
Bestimmte Vermögensgüter, wie eingebrachte, geschenkte oder ererbte Sachen, sind gemäß § 82 Abs. 1 EheG von der Aufteilung ausgenommen. Eine Ausnahme besteht jedoch für eine ererbte oder geschenkte Ehewohnung, die unter bestimmten Umständen dennoch in die Aufteilung einbezogen werden kann (§ 82 Abs. 2 EheG) Deixler-Hübner, Ausnahmen vom Aufteilungsvermögen (Stand 26.4.2023, Lexis Briefings in lexis360.at).
Das Gericht kann gemäß § 87 Abs. 1 EheG die Übertragung des Eigentums oder eines dinglichen Rechts an der Ehewohnung von einem auf den anderen Ehegatten anordnen oder ein schuldrechtliches Rechtsverhältnis zugunsten eines Ehegatten begründen. Die Ehegatten können jedoch durch Vereinbarung die Übertragung ausschließen § 87 EheG.
Falls die Ehegatten eine Trennungsvereinbarung abschließen, können sie die Aufteilung der Immobilie und anderer Vermögenswerte vorab regeln, um Streitigkeiten im Scheidungsverfahren zu vermeiden Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Trennungsvereinbarungen, BFG 31.01.2017, RV 7104691/2015.
Die Obsorge für Kinder nach einer Scheidung wird in Österreich durch gesetzliche Regelungen und gerichtliche Verfahren bestimmt:
Grundsatz der Obsorge beider Elternteile:
Nach § 177 ABGB bleibt die Obsorge beider Eltern grundsätzlich aufrecht, auch nach der Scheidung. Die Eltern können jedoch dem Gericht eine Vereinbarung vorlegen, die entweder einem Elternteil die alleinige Obsorge überträgt oder die Obsorge eines Elternteils auf bestimmte Angelegenheiten beschränkt § 177 ABGB, OGH 20.12.2010, 5 Ob 202/10g, § 179 ABGB.
Vereinbarung über den hauptsächlichen Aufenthalt des Kindes:
Gemäß § 179 Abs. 2 ABGB müssen die Eltern bei gemeinsamer Obsorge eine Vereinbarung darüber schließen, bei welchem Elternteil das Kind hauptsächlich betreut wird. Diese Vereinbarung erfolgt vor Gericht § 179 ABGB, Huber, Obsorge (Stand 04.4.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung:
Wenn keine Einigung zwischen den Eltern erzielt wird oder ein Antrag auf alleinige Obsorge gestellt wird, kann das Gericht gemäß § 180 ABGB eine vorläufige Regelung treffen. Diese Phase dauert sechs Monate und dient dazu, das Kindeswohl zu prüfen und eine endgültige Entscheidung zu treffen Huber, Obsorge (Stand 04.4.2025, Lexis Briefings in lexis360.at), § 180 ABGB.
Einvernehmliche Scheidung und Obsorgevereinbarung:
Nach § 55a Abs. 2 EheG ist eine schriftliche Vereinbarung über die Obsorge der Kinder Voraussetzung für eine einvernehmliche Scheidung. Diese Vereinbarung umfasst auch die Betreuung, das Kontaktrecht und die Unterhaltspflichten § 55a EheG, Weinrich, Scheidungsfolgen – Allgemein (Stand 26.2.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Kindeswohl als oberste Priorität:
Gemäß § 190 ABGB müssen alle Vereinbarungen und gerichtlichen Entscheidungen das Wohl des Kindes bestmöglich wahren. Das Gericht kann Vereinbarungen für unwirksam erklären und abweichende Anordnungen treffen, wenn das Kindeswohl gefährdet ist § 190 ABGB.
Die Berechnung des Kindesunterhalts bei einer Scheidung in Österreich erfolgt gemäß § 231 ABGB. Die Eltern sind verpflichtet, anteilig zur Deckung der angemessenen Bedürfnisse des Kindes beizutragen, wobei die Lebensverhältnisse des Kindes sowie die finanziellen Möglichkeiten der Eltern berücksichtigt werden § 231 ABGB.
Der Elternteil, der das Kind betreut und den Haushalt führt, leistet seinen Beitrag durch Naturalunterhalt. Der andere Elternteil ist verpflichtet, Geldunterhalt zu leisten, soweit dies erforderlich ist, um die Bedürfnisse des Kindes vollständig zu decken § 231 ABGB.
Die Höhe des Kindesunterhalts wird häufig anhand des sogenannten Regelbedarfs bemessen, der altersabhängig festgelegt ist. In einem Fall entschied der Oberste Gerichtshof, dass der Kindesunterhalt primär auf Basis des Regelbedarfssatzes berechnet wird, unabhängig vom Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils OGH 27.01.1998, 4 Ob 4/98m.
Darüber hinaus mindert sich der Anspruch auf Unterhalt insoweit, als das Kind eigene Einkünfte hat oder selbsterhaltungsfähig ist § 231 ABGB. Vereinbarungen zwischen den Eltern über den Kindesunterhalt sind nur wirksam, wenn sie im Rahmen einer umfassenden Scheidungsfolgenregelung vor Gericht getroffen werden § 231 ABGB, OGH 4 Ob 141/24z = Zak 2024/654 (Kolmasch).
Im Falle einer Ehescheidung wird das Vermögen der Ehegatten gemäß den Bestimmungen des österreichischen Ehegesetzes (EheG) aufgeteilt. Die rechtlichen Grundlagen sind wie folgt:
Aufteilungsmasse:
Das aufzuteilende Vermögen umfasst das eheliche Gebrauchsvermögen und die ehelichen Ersparnisse (§ 81 Abs. 1 EheG). Eheliches Gebrauchsvermögen sind bewegliche und unbewegliche Sachen, die während der Ehe dem gemeinsamen Gebrauch der Ehegatten gedient haben, einschließlich Hausrat und Ehewohnung (§ 81 Abs. 2 EheG). Eheliche Ersparnisse sind Wertanlagen, die während der Ehe angesammelt wurden und üblicherweise für eine Verwertung bestimmt sind (§ 81 Abs. 3 EheG) § 81 EheG, OGH 27.10.1994, 2 Ob 581/93, Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Aufteilung (Ehe)Vermögen.
Ausnahmen von der Aufteilung:
Bestimmte Vermögensgegenstände sind von der Aufteilung ausgenommen, darunter Sachen, die ein Ehegatte in die Ehe eingebracht, geerbt oder geschenkt bekommen hat, sowie Gegenstände, die dem persönlichen Gebrauch oder der Berufsausübung eines Ehegatten dienen (§ 82 Abs. 1 EheG). Unternehmensbestandteile und Unternehmensanteile sind ebenfalls ausgenommen, es sei denn, sie stellen bloße Wertanlagen dar (§ 82 Abs. 1 Z 3 und Z 4 EheG) § 82 EheG, Deixler-Hübner, Ausnahmen vom Aufteilungsvermögen (Stand 26.4.2023, Lexis Briefings in lexis360.at), Deixler-Hübner, Beitragsleistungen für das Unternehmen des Ehegatten - im Scheidungsfall ausgleichsfähig oder bloßer Liebesbeweis?, RdFU 2025/3.
Kriterien für die Aufteilung:
Die Aufteilung erfolgt nach Billigkeit (§ 83 Abs. 1 EheG). Dabei werden die Beiträge jedes Ehegatten zur Anschaffung des Vermögens, die Pflege und Erziehung gemeinsamer Kinder sowie der Unterhalt berücksichtigt (§ 83 Abs. 2 EheG) § 83 EheG.
Schulden:
Schulden, die mit dem ehelichen Gebrauchsvermögen und den ehelichen Ersparnissen in einem inneren Zusammenhang stehen, werden ebenfalls in die Aufteilung einbezogen (§ 81 Abs. 1 EheG) § 81 EheG, Deixler-Hübner, Schulden - nacheheliche Vermögensaufteilung (Stand 26.4.2023, Lexis Briefings in lexis360.at).
Sonderregelungen bei Vermögensminderung: Wenn ein Ehegatte ohne Zustimmung des anderen das eheliche Gebrauchsvermögen oder die ehelichen Ersparnisse innerhalb von zwei Jahren vor der Scheidung verringert hat, wird der Wert des Fehlenden in die Aufteilung einbezogen (§ 91 Abs. 1 EheG) § 91 EheG.
Gerichtliche Entscheidung:
Wenn sich die Ehegatten nicht einvernehmlich über die Vermögensaufteilung einigen können, entscheidet das Gericht auf Antrag (§ 85 EheG) § 85 EheG.
Die Verpflichtung zur Zahlung von Ehegattenunterhalt ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen des österreichischen Rechts, insbesondere aus § 94 ABGB und § 67 EheG.
Gemäß § 94 ABGB sind Ehegatten verpflichtet, nach ihren Kräften und entsprechend der Gestaltung ihrer ehelichen Lebensgemeinschaft zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse beizutragen. Der Ehegatte, der den gemeinsamen Haushalt führt, leistet dadurch seinen Beitrag und hat einen Anspruch auf Unterhalt gegen den anderen Ehegatten, wobei eigene Einkünfte angemessen berücksichtigt werden § 94 ABGB, BFG 17.07.2019, RV 5101557/2017. Nach der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts besteht der Unterhaltsanspruch grundsätzlich weiter, sofern der Anspruch nicht verwirkt wurde, etwa durch missbräuchliches Verhalten § 94 ABGB, Hackl, Eheliche Pflichten – Allgemein (Stand 25.2.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Nach einer Scheidung kann ein Ehegatte unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin unterhaltspflichtig sein. Gemäß § 67 EheG ist der allein oder überwiegend schuldige Ehegatte verpflichtet, Unterhalt zu leisten, soweit dies mit Rücksicht auf die Bedürfnisse und die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der geschiedenen Ehegatten der Billigkeit entspricht. Die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen wird dabei berücksichtigt § 67 EheG.
Im österreichischen Recht werden Schulden im Rahmen einer Scheidung gemäß den Bestimmungen des Ehegesetzes (EheG) behandelt. Die relevanten Regelungen sind in § 81 und § 83 EheG festgelegt.
Grundsätze der Schuldenaufteilung:
Gemäß § 81 Abs. 1 EheG sind Schulden, die mit dem ehelichen Gebrauchsvermögen und den ehelichen Ersparnissen in einem inneren Zusammenhang stehen, in die Aufteilung einzubeziehen § 81 EheG, OGH 27.04.2004, 10 Ob 15/04k, BFG 15.07.2019, RV 7100572/2014.
Schulden, die mit dem ehelichen Lebensaufwand zusammenhängen, sind ebenfalls zu berücksichtigen, soweit sie nicht bereits nach § 81 EheG in Anschlag gebracht wurden (§ 83 Abs. 1 EheG) § 83 EheG, OGH 21.01.2003, 4 Ob 11/03a.
Billigkeitsprinzip:
Die Aufteilung der Schulden erfolgt nach Billigkeit (§ 83 Abs. 1 EheG). Dabei wird insbesondere darauf geachtet, welcher Ehegatte die mit der Schuld verbundenen Vermögensgegenstände erhält § 83 EheG, OGH 21.01.2003, 4 Ob 11/03a.
Fristen und Verfahren:
Der Anspruch auf Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse, einschließlich der Schulden, erlischt, wenn er nicht binnen einem Jahr nach Rechtskraft der Scheidung gerichtlich geltend gemacht wird (§ 95 EheG) § 95 EheG.
Unternehmensschulden:
Schulden, die im Zusammenhang mit einem Unternehmen eines Ehegatten stehen, sind von der Aufteilung ausgeschlossen. Das Unternehmensvermögen, einschließlich seiner Schulden, bildet einen eigenen Vermögenskreis und wird nicht in die Aufteilungsmasse einbezogen Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Aufteilung und Unternehmen?.
Ein Verzicht auf Unterhalt im Rahmen einer Scheidung ist nach österreichischem Recht unter bestimmten Voraussetzungen möglich:
Einvernehmliche Scheidung (§ 55a EheG):
Bei einer einvernehmlichen Scheidung ist eine schriftliche Vereinbarung über die unterhaltsrechtlichen Beziehungen der Ehegatten erforderlich. Diese Vereinbarung kann auch einen wechselseitigen Unterhaltsverzicht beinhalten § 55a EheG, Weinrich, Scheidungsfolgen – Allgemein (Stand 26.2.2025, Lexis Briefings in lexis360.at), Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht10 (2022).
Formfreiheit und Schriftlichkeit:
Ein Unterhaltsverzicht kann grundsätzlich formfrei erfolgen. Im Rahmen einer einvernehmlichen Scheidung ist jedoch Schriftform vor Gericht erforderlich (§ 55a Abs. 2 EheG) Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht10 (2022), Kolmasch, Unterhaltsverzicht (Stand 23.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at), OGH 10.10.2017, 10 Ob 42/17z.
Rechtswirksamkeit und Einschränkungen:
Der Unterhaltsverzicht ist wirksam, solange er nicht sittenwidrig ist oder den notwendigen Lebensunterhalt des Berechtigten gefährdet. Er unterliegt der sogenannten Umstandsklausel, wonach der Verzicht hinfällig wird, wenn sich die Verhältnisse wesentlich ändern und der Unterhaltsberechtigte seinen notwendigen Lebensaufwand nicht mehr selbst tragen kann. Diese Klausel kann jedoch vertraglich ausgeschlossen werden, wobei der Ausschluss nicht aufrechterhalten werden darf, wenn der Unterhaltsberechtigte in eine existenzbedrohende Lage gerät Kolmasch, Unterhaltsverzicht (Stand 23.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at), OGH 9 ObA 106/22m = ARD 6853/7/2023 (Lindmayr), Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Ehepakte, Eheübereinkommen und Vorwegvereinbarungen.
Unverzichtbarkeit während der Ehe (§ 94 Abs. 3 ABGB):
Auf den Unterhaltsanspruch kann im Vorhinein während der Ehe nicht verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur nach der Scheidung und für die Zukunft möglich Leb in Leb (Hrsg), Unternehmen und Ehe2 (2021) Ehepakte, Eheübereinkommen und Vorwegvereinbarungen, § 94 ABGB.
Gleichstellung des vereinbarten Unterhalts (§ 69a EheG):
Der aufgrund einer Vereinbarung nach § 55a Abs. 2 EheG geschuldete Unterhalt wird einem gesetzlichen Unterhalt gleichgestellt, soweit er den Lebensverhältnissen der Ehegatten angemessen ist OGH 9 ObA 106/22m = ARD 6853/7/2023 (Lindmayr), § 69a EheG.
Schlüssigkeit des Verzichts:
Ein schlüssiger Unterhaltsverzicht ist nur dann anzunehmen, wenn der Verzichtswille eindeutig und unzweifelhaft ist. Aus der bloßen unterlassenen Geltendmachung von Unterhaltsleistungen kann kein Verzicht abgeleitet werden Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht10 (2022), Kolmasch, Unterhaltsverzicht (Stand 23.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Ein Scheidungsfolgenvergleich ist eine schriftliche Vereinbarung, die im Rahmen einer einvernehmlichen Scheidung gemäß § 55a Abs. 2 EheG abgeschlossen wird. Diese Vereinbarung regelt die Betreuung und Obsorge der gemeinsamen Kinder, das Recht auf persönliche Kontakte, die Unterhaltspflichten sowie die vermögensrechtlichen Ansprüche der Ehegatten für den Fall der Scheidung § 55a EheG, § 95 AußStrG.
Rechtlich gesehen handelt es sich um einen privatrechtlichen Vertrag, der die Ehegatten bindet, auch wenn die im § 55a Abs. 2 EheG geforderte Form nicht eingehalten wird OGH 6Ob2155/96x (RS0106968), OGH 29.11.2017, 8 Ob 106/17x. Der Vergleich wird unter der Bedingung der rechtskräftigen Scheidung geschlossen und verliert seine Wirksamkeit, wenn die Scheidung nicht zustande kommt, etwa durch Rücknahme des Scheidungsantrags OGH 6Ob2155/96x (RS0106968), Hackl, Einvernehmliche Scheidung (Stand 24.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Ein Scheidungsfolgenvergleich kann auch als gerichtlicher Vergleich abgeschlossen werden, wobei das Gericht die Vereinbarung protokolliert und die Parteien anleitet, falls sie nicht anwaltlich vertreten sind. Der Vergleich ist ein Exekutionstitel gemäß § 1 Z 5 EO und kann ab Rechtskraft der Scheidung durchgesetzt werden. Regelungen betreffend minderjährige Kinder können jedoch nur nach §§ 79 Abs. 2 und 110 AußStrG durchgesetzt werden Hackl, Einvernehmliche Scheidung (Stand 24.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Die Vereinbarung ist anfechtbar, etwa wegen Willensmängeln oder Sittenwidrigkeit. Beispielsweise ist ein Unterhaltsvergleich sittenwidrig, wenn er die Existenzgrundlage eines Ehegatten gefährdet OGH 29.11.2017, 8 Ob 106/17x, Aigner in Aigner (Hrsg), Der zivilrechtliche Vergleich (2022) XIII. Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse. Die Anfechtung des Vergleichs hat jedoch keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Scheidungsbeschlusses OGH 29.11.2017, 8 Ob 106/17x, OGH 29.04.2009, 2 Ob 70/09x.
Scheidungen verstehen, bevor es ernst wird
Neueste Entwicklungen im Scheidungsrecht und darüber hinaus.
Scheidung regeln, bevor es andere tun
Niemand plant gerne das Ende einer Ehe. Doch wer rechtzeitig vorsorgt, schützt sich – rechtlich, finanziell und emotional. Ein Ehevertrag oder eine klare Trennungsvereinbarung kann Konflikte verhindern, Vermögen sichern und langwierige Verfahren vermeiden. Vorsorge im Scheidungsrecht beginnt nicht erst mit dem Bruch – sie beginnt mit dem Bewusstsein, dass auch Beziehungen klare Regeln brauchen. Und sie reicht weiter: Obsorge, Unterhalt, Wohnrecht – wer vorausdenkt, entscheidet mit.
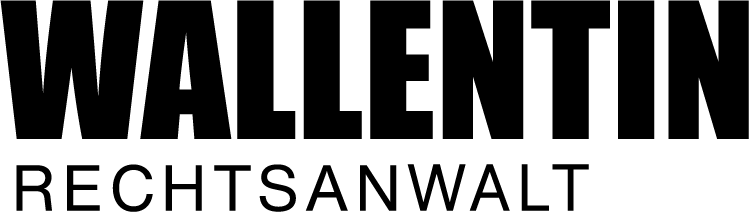


.jpg)