Ihr Wille. Klar geregelt.
Erben ist menschlich. Streiten auch. Deshalb braucht es einen kühlen Kopf, wenn Gefühle hochkochen und Vermögen auf dem Spiel steht. Ich bringe Struktur in komplexe Erbfälle – mit klarem Blick, strategischem Denken und juristischer Präzision. Ob Gestaltung, Absicherung oder Durchsetzung.
Wer klar regelt, was kommt, schützt seine Liebsten – und verhindert Streit, bevor er entsteht.
Erbstreitigkeiten verlangen Klarheit. Ich vertrete Ihre Position – kompromissbereit, wenn möglich. Konsequent, wenn nötig.
Unrecht beginnt oft leise. Ich decke gezielte Einflussnahme auf und kämpfe für eine faire Nachlassverteilung.
Ich übernehme Verantwortung – sorge für klare Abläufe, sichere Werte und entlaste Sie in einer sensiblen Zeit.
Plötzlich
Alleinerbe.
Erbschleicherei beginnt leise – mit kleinen Geschenken, vermeintlicher Nähe, gezieltem Einfluss. Am Ende steht ein Testament, das niemand versteht – außer dem, der davon profitiert. Ich decke Manipulation auf, prüfe Testamente auf Wirksamkeit und kämpfe für eine gerechte Nachlassverteilung. Mit Erfahrung, Fingerspitzengefühl – und einer klaren Strategie.

„Im Erbrecht steckt viel mehr, als man denkt. Ich sehe immer wieder, dass die Gegenseite Fehler macht und Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden. Man erbt meistens nur einmal und bekommt keine zweite Chance, wenn man einen Fehler gemacht hat. “

Enterbt?
Der Pflichtteil schützt nahe Angehörige – selbst dann, wenn sie im Testament übergangen wurden. Kinder, Ehepartner, Eltern: Wer zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten gehört, hat Anspruch. Und zwar in bar, sofort und in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
Wenn Erben
zum Konflikt wird.
Ein Erbfall bringt nicht nur Vermögen – er bringt oft alte Konflikte ans Licht. Was früher unausgesprochen blieb, eskaliert plötzlich am Verhandlungstisch. Wer bekommt das Haus? Wer hat sich gekümmert? Wer fühlt sich übergangen? Ich führe Sie durch diese heikle Phase – mit kühlem Kopf, juristischer Klarheit und dem Gespür für Dynamiken, die tiefer reichen als Paragrafen.

Erbrecht verständlich erklärt
Neueste Entwicklungen im Erbrecht und darüber hinaus.
Fragen zum Erbrecht
Erben wirft Fragen auf. Viele. Und oft dann, wenn es schnell gehen muss.Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Themen – verständlich, kompakt und juristisch fundiert. Damit Sie wissen, worauf es ankommt.
Die Errichtung eines Testaments in Österreich unterliegt strengen Formvorschriften, die im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) geregelt sind. Diese Vorschriften dienen der Warnfunktion, um dem Testator die Bedeutung seiner Erklärung bewusst zu machen, und der Beweisfunktion, um Streitigkeiten nach seinem Tod zu vermeiden OGH 08.05.1985, 1 Ob 539/85, OGH 23.05.1996, 6 Ob 2125/96k.
Formen der letztwilligen Verfügung:
Ein eigenhändiges Testament muss vom Erblasser vollständig eigenhändig geschrieben und unterschrieben werden (§ 578 ABGB) OGH 25.07.2019, 2 Ob 19/19m.
Ein fremdhändiges Testament muss vom Erblasser eigenhändig unterschrieben und mit einem eigenhändig geschriebenen Zusatz versehen werden, dass die Urkunde seinen letzten Willen enthält. Zudem müssen drei gleichzeitig anwesende Zeugen die Urkunde unterschreiben (§ 579 ABGB) § 579 ABGB.
Ein öffentliches Testament kann vor zwei Notaren oder einem Notar und zwei Zeugen schriftlich oder mündlich errichtet werden (§ 583 ABGB) § 583 ABGB.
Zwingende Formvorschriften:
Die Einhaltung der Formvorschriften ist zwingend. Wird eine Formvorschrift nicht eingehalten, ist die letztwillige Verfügung ungültig (§ 601 ABGB) § 601 ABGB.
Selbst bei eindeutigem Willen des Erblassers ist eine nicht formgerechte Verfügung ungültig OGH 25.07.2019, 2 Ob 19/19m.
Besondere Anforderungen:
Für Minderjährige und Personen mit Sachwalter müssen zusätzliche Anforderungen erfüllt werden, wie die Erforschung des freien Willens durch das Gericht (§ 569 ABGB) OGH 23.05.1996, 6 Ob 2125/96k, OGH 21.11.1994, 9 Ob 1615/94.
Die Wahl der Testamentsform liegt grundsätzlich beim Testator, und alle Formen sind gleichrangig OGH 08.05.1985, 1 Ob 539/85, Nemeth, Form der letztwilligen Verfügung (Stand 12.7.2019, Lexis Briefings in lexis360.at).
Ein Testament kann im österreichischen Recht aus verschiedenen Gründen ungültig sein:
Formmängel:
Ein fremdhändiges Testament ist formungültig, wenn der Erblasser auf einem losen Blatt unterschrieben hat, ohne dass ein räumlicher oder inhaltlicher Zusammenhang mit dem Text der letztwilligen Verfügung besteht OGH 2Ob143/19x; 2Ob145/19s; 2Ob218/19a; 2Ob51/20v; 2Ob143/20y; 2Ob141/20d; 2Ob188/20s; 2Ob4/21h; 2Ob29/22m; 2Ob25/22y; 2Ob239/22v; 2Ob226/22g; 7Ob38/24z; 2Ob197/24w (RS0132929). Ebenso ist ein Testament ungültig, wenn es nicht vom Erblasser unterzeichnet wurde OGH 29.01.2019, 2 Ob 126/18w. Ein weiterer Grund für die Ungültigkeit kann das Fehlen eines erforderlichen Zeugenzusatzes oder die Abwesenheit der Zeugen bei der Errichtung des Testaments sein OGH 30.04.2020, 2 Ob 58/19x.
Testierunfähigkeit:
Ein Testament ist ungültig, wenn der Erblasser zum Zeitpunkt der Errichtung testierunfähig war. Testierunfähigkeit liegt vor, wenn das Bewusstsein des Erblassers so beeinträchtigt ist, dass die normale Freiheit seiner Willensbildung durch eine geistige Erkrankung aufgehoben ist. Dies kann beispielsweise durch paranoide Wahnvorstellungen oder andere dauernde oder vorübergehende Störungen der Entschlussfreiheit verursacht werden OGH 14.10.2003, 1 Ob 28/03d, OGH 27.09.1988, 2 Ob 609/87.
Irrtum des Erblassers:
Ein Testament kann ungültig sein, wenn es aufgrund eines relevanten Irrtums des Erblassers errichtet wurde. Ein solcher Irrtum muss jedoch nachgewiesen werden OGH 18.12.2020, 2 Ob 122/20k.
Gemäß österreichischem Recht tritt die gesetzliche Erbfolge ein, wenn der Verstorbene kein Testament errichtet hat, keinen Erbvertrag abgeschlossen hat oder die eingesetzten Erben die Erbschaft nicht antreten können oder wollen (§ 727 ABGB) § 727 ABGB.
Die gesetzliche Erbfolge richtet sich nach dem sogenannten Parentelensystem, das in § 731 ABGB geregelt ist.
Die Verwandten des Verstorbenen werden in vier Linien eingeteilt:
Erste Linie: Kinder des Verstorbenen und deren Nachkommen.
Zweite Linie: Eltern des Verstorbenen und deren Nachkommen (Geschwister und deren Nachkommen).
Dritte Linie: Großeltern des Verstorbenen und deren Nachkommen (Onkel, Tanten und deren Nachkommen).
Vierte Linie: Urgroßeltern des Verstorbenen § 731 ABGB.
Innerhalb der Parentelen gilt, dass die nähere Parentel die weiter entfernte ausschließt. Beispielsweise erben die Eltern des Verstorbenen nur, wenn keine Kinder vorhanden sind Nemeth, Gesetzliche Erbfolge (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Zusätzlich wird der Ehegatte oder eingetragene Partner des Verstorbenen berücksichtigt. Der Lebensgefährte hat ein gesetzliches Erbrecht im letzten Rang, falls keine anderen Erben vorhanden sind Nemeth, Gesetzliche Erbfolge (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Der Pflichtteil im österreichischen Erbrecht ist ein gesetzlich garantierter Anteil am Vermögen des Verstorbenen, der bestimmten Personen zusteht, unabhängig vom Willen des Erblassers (§ 756 ABGB) § 756 ABGB. Pflichtteilsberechtigt sind die Nachkommen sowie der Ehegatte oder eingetragene Partner des Verstorbenen (§ 757 ABGB) § 757 ABGB. Voraussetzung für den Anspruch ist, dass diesen Personen bei gesetzlicher Erbfolge ein Erbrecht zustünde, sie nicht enterbt wurden und nicht auf den Pflichtteil verzichtet haben (§ 758 ABGB) § 758 ABGB, OGH 25.10.2023, 2 Ob 163/23v.
Die Höhe des Pflichtteils beträgt die Hälfte dessen, was der Pflichtteilsberechtigte nach der gesetzlichen Erbfolge erhalten hätte (§ 759 ABGB) § 759 ABGB. Das Ziel des Pflichtteilsrechts ist es, den Pflichtteilsberechtigten an einem bestimmten Teil des Vermögens des Erblassers zu beteiligen, das ihm zum Zeitpunkt seines Ablebens zur Verfügung stand (§ 781 ABGB) OGH 8Ob527/86 (RS0012852), § 781 ABGB. Lebzeitige Schenkungen des Erblassers können bei der Berechnung des Pflichtteils berücksichtigt werden (§ 781 ABGB) § 781 ABGB.Was lebt der Lebensgefährte in Österreich?Wer erbt was in Patchworkfamilien?Die gesetzliche Erbfolge in Österreich richtet sich nach dem Parentelensystem, das die Verwandten des Verstorbenen nach ihrem Verwandtschaftsgrad einteilt (§ 731 ABGB). Innerhalb einer Parentel gelten die Grundsätze des Erbens nach Stämmen und der Repräsentation, wobei die nähere Parentel die weiter entfernte ausschließt Nemeth, Gesetzliche Erbfolge (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
In Patchworkfamilien ist zu beachten, dass die gesetzliche Erbfolge nur leibliche oder adoptierte Kinder des Verstorbenen berücksichtigt. Stiefkinder haben kein gesetzliches Erbrecht, es sei denn, sie wurden vom Verstorbenen adoptiert (§ 184 ABGB) Schrank, Leitentscheidungen der Höchstgerichte zum Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht (44. Lfg 2015) Wer gilt als anderer Eltern- bzw. Pflegeelternteil? - Wechsel von leiblicher Mutter zu Verpartnerter? - OGH 21.10.2014, 10 ObS 68/14v. Halbgeschwister repräsentieren nur den Elternteil, von dem sie abstammen (§ 736 ABGB) Nemeth, Gesetzliche Erbfolge (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Falls der Verstorbene ein Testament hinterlässt, kann er die Erbfolge individuell regeln und beispielsweise auch Stiefkinder oder andere Personen berücksichtigen (§ 731 ABGB) Nemeth, Gesetzliche Erbfolge (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at). Ohne ein Testament gilt ausschließlich die gesetzliche Erbfolge nach den Bestimmungen des ABGB (§§ 731 bis 741 ABGB) Nemeth, Gesetzliche Erbfolge (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at), § 741 ABGB.
Geschwister sind gemäß österreichischem Recht erbberechtigt, wenn sie zur zweiten Parentel gehören. Die gesetzliche Grundlage hierfür ist § 731 ABGB, der die Erbfolge nach Parentelen regelt. Geschwister und deren Nachkommen zählen zur zweiten Linie, die nur dann erbberechtigt ist, wenn keine direkten Nachkommen des Verstorbenen (erste Linie) vorhanden sind § 731 ABGB, Hackl, Arbeitsbuch Herbst 2015 (2015).
Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten oder eingetragenen Partners verdrängt seit der Erbrechts-Änderung 2015 das Erbrecht von Geschwistern und Großeltern, wenn keine Kinder oder Eltern des Verstorbenen vorhanden sind (§ 744 ABGB nF). In solchen Fällen steht dem Ehegatten oder eingetragenen Partner die gesamte Verlassenschaft zu Hackl, Arbeitsbuch Herbst 2015 (2015), Kolmasch, Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (Stand 24.2.2018, Lexis Briefings in lexis360.at).
Geschwister sind gemäß österreichischem Recht erbberechtigt, wenn sie zur zweiten Parentel gehören. Die gesetzliche Grundlage hierfür ist § 731 ABGB, der die Erbfolge nach Parentelen regelt. Geschwister und deren Nachkommen zählen zur zweiten Linie, die nur dann erbberechtigt ist, wenn keine direkten Nachkommen des Verstorbenen (erste Linie) vorhanden sind § 731 ABGB, Hackl, Arbeitsbuch Herbst 2015 (2015).
Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten oder eingetragenen Partners verdrängt seit der Erbrechts-Änderung 2015 das Erbrecht von Geschwistern und Großeltern, wenn keine Kinder oder Eltern des Verstorbenen vorhanden sind (§ 744 ABGB nF). In solchen Fällen steht dem Ehegatten oder eingetragenen Partner die gesamte Verlassenschaft zu Hackl, Arbeitsbuch Herbst 2015 (2015), Kolmasch, Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (Stand 24.2.2018, Lexis Briefings in lexis360.at).
Eltern sind gemäß österreichischem Recht unter bestimmten Voraussetzungen erbberechtigt. Die gesetzliche Erbfolge richtet sich nach dem Parentelensystem, das in § 731 ABGB geregelt ist. Nach diesem System gehören die Eltern des Verstorbenen zur zweiten Linie, die nur dann erbberechtigt ist, wenn keine direkten Nachkommen (erste Linie) vorhanden sind § 731 ABGB, Nemeth, Gesetzliche Erbfolge (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at). Innerhalb der zweiten Linie erben die Eltern des Verstorbenen zu gleichen Teilen § 731 ABGB.
Gemäß § 744 ABGB erbt der Ehegatte oder eingetragene Partner des Verstorbenen neben den Eltern zu zwei Dritteln der Verlassenschaft. Ist ein Elternteil vorverstorben, fällt dessen Anteil ebenfalls dem Ehegatten oder eingetragenen Partner zu § 744 ABGB. Die gesetzliche Erbfolge tritt nur ein, wenn kein Testament oder Erbvertrag vorliegt oder die eingesetzten Erben aus bestimmten Gründen nicht zur Erbschaft gelangen können, wie etwa durch Erbunwürdigkeit oder Ausschlagung der Erbschaft (§ 727 ff ABGB) Nemeth, Gesetzliche Erbfolge (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Bei Verdacht auf Erbschleicherei können im österreichischen Recht folgende rechtliche Schritte unternommen werden:
Erbschaftsklage:
Die durch die Einantwortung geschaffene Rechtsvermutung, dass der in den Erbschaftsbesitz eingewiesene Erbe der wahre Erbe ist, kann durch eine gerichtliche Feststellung des Erbrechts eines anderen beseitigt werden. Dies erfolgt durch eine Erbschaftsklage gemäß der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs OGH 1Ob155/46 (RS0008381), OGH 19.11.2019, 10 Ob 70/19w.
Nichtigkeit von Rechtsgeschäften:
Rechtsgeschäfte, die auf die Übertragung oder Belastung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses gerichtet sind, die man von einer dritten Person erhofft, sind gemäß § 879 Abs. 2 Z 3 ABGB bei deren Lebzeiten nichtig. Der Zweck dieser Regelung ist die Verhinderung von unsittlicher Spekulation auf den Tod eines Dritten Aigner in Aigner (Hrsg), Der zivilrechtliche Vergleich (2022) V. Gegenstand des Vergleiches.
Auskunftsanspruch über Schenkungen:
Pflichtteilsberechtigte haben gemäß § 786 ABGB einen Anspruch auf Auskunft über das Verlassenschaftsvermögen und Schenkungen. Dieser Anspruch kann dazu dienen, unrechtmäßige Zuwendungen aufzudecken, die möglicherweise im Zusammenhang mit Erbschleicherei stehen Entleitner, Der Auskunftsanspruch über Schenkungen gem § 786 ABGB, Zak 2022/188.
Prüfung von Willensmängeln:
Willensmängel bei der Erbverfügung, wie Täuschung oder Zwang, können im außerstreitigen Verfahren über das Erbrecht oder im Rahmen einer Erbschaftsklage geltend gemacht werden OGH 2Ob361/48 (RS0013043).
Ein Testament kann unter bestimmten Voraussetzungen angefochten werden. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind im österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) sowie in der Rechtsprechung geregelt:
Irrtum des Erblassers:
Ein Testament kann angefochten werden, wenn der Erblasser bei der Errichtung der letztwilligen Verfügung einem Irrtum unterlag. Dies umfasst sowohl Irrtümer über den Inhalt der Verfügung als auch Motivirrtümer, also Irrtümer im Beweggrund. Die Anfechtung wegen eines Motivirrtums ist in § 572 ABGB geregelt Brandstätter, Motivirrtum - Erbrecht (Stand 29.6.2023, Lexis Briefings in lexis360.at).
Formmängel:
Wenn ein Testament nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form errichtet wurde, kann es angefochten werden. Beispielsweise ist die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers nur bei einer formgültigen letztwilligen Verfügung wirksam (§ 552 Abs 2 ABGB) OGH 2 Ob 61/24w = Zak 2024/379 (Kolmasch).
Echtheitszweifel: Die Echtheit eines Testaments kann bestritten werden, wenn begründete Zweifel an der Authentizität bestehen. Dies wurde in der Rechtsprechung des OGH thematisiert, etwa in Fällen, in denen die Form oder der Inhalt eines Testaments strittig ist OGH 5Ob255/67 (RS0008066).
Willensmängel:
Ein Testament kann auch angefochten werden, wenn Willensmängel wie Täuschung oder Zwang bei der Errichtung der letztwilligen Verfügung vorliegen. Dies ergibt sich aus den allgemeinen vertragsrechtlichen Regeln des ABGB Nemeth, Erbverzicht (Stand 12.7.2019, Lexis Briefings in lexis360.at).
Vererblichkeit des Anfechtungsrechts:
Das Recht, ein Testament anzufechten, ist vererblich und kann von den gesetzlich oder testamentarisch zur Erbfolge berufenen Personen geltend gemacht werden. Dies wurde durch die Rechtsprechung des OGH bestätigt OGH 14.07.1948, 1 Ob 217/48.
Die Anfechtung eines Testaments erfolgt in der Regel durch die gesetzlich oder testamentarisch zur Erbfolge berufenen Personen, die ihre Erbansprüche im Rahmen eines Verlassenschaftsverfahrens geltend machen können OGH 6Ob182/59 (RS0025526).
Das Recht, ein Testament anzufechten, unterliegt einer Verjährungsfrist von drei Jahren gemäß § 1487 ABGB. Diese Frist beginnt spätestens mit der Einantwortung des Nachlasses, unabhängig davon, ob der Berechtigte von den Anfechtungsgründen Kenntnis erlangt hat OGH 11.10.1994, 1 Ob 540/94, OGH 29.01.1980, 4 Ob 602/79. Die Anfechtung eines Testaments muss in einem gerichtlichen Verfahren geltend gemacht werden, wobei die gesetzlich oder testamentarisch zur Erbfolge berufenen Personen klagsberechtigt sind (§ 812 ABGB) OGH 6Ob182/59 (RS0025526), OGH 3Ob26/38 (RS0015529).
Pflichtteilsberechtigt nach österreichischem Recht sind gemäß § 757 ABGB die Nachkommen sowie der Ehegatte oder eingetragene Partner des Verstorbenen § 757 ABGB.
Ein Pflichtteil steht diesen Personen zu, wenn sie bei gesetzlicher Erbfolge ein Erbrecht hätten, nicht enterbt wurden und nicht auf den Pflichtteil verzichtet haben (§ 758 Abs. 1 ABGB). Den Nachkommen einer erbunfähigen, enterbten oder vorverstorbenen Person steht ebenfalls ein Pflichtteil zu, sofern sie die Voraussetzungen des § 758 Abs. 1 ABGB erfüllen § 758 ABGB.
Die Pflichtteilsberechtigung setzt voraus, dass keine gültige Enterbung vorliegt und die genannten Personen bei gesetzlicher Erbfolge als Erben in Betracht kämen (§ 758 ABGB) § 758 ABGB, OGH 25.10.2023, 2 Ob 163/23v.
Die Höhe des Pflichtteils beträgt die Hälfte dessen, was der pflichtteilsberechtigten Person nach der gesetzlichen Erbfolge zustünde (§ 759 ABGB) § 759 ABGB. Kein Anspruch besteht, wenn die genannten Personen erbunwürdig sind (§§ 539 ff ABGB), gültig enterbt wurden (§§ 769 ff ABGB) oder auf den Pflichtteil gültig verzichtet haben (§ 551 ABGB) Nemeth, Pflichtteilsanspruch (Stand 20.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Die Fristen für die Geltendmachung des Pflichtteils und die Anfechtung im österreichischen Erbrecht sind wie folgt geregelt:
Pflichtteilsansprüche:
Der Pflichtteilsberechtigte erwirbt den Anspruch mit dem Tod des Verstorbenen (§ 765 Abs. 1 ABGB) § 765 ABGB.
Den Geldpflichtteil kann der Pflichtteilsberechtigte erst ein Jahr nach dem Tod des Verstorbenen fordern (§ 765 Abs. 2 ABGB) § 765 ABGB.
Die Verjährung des Pflichtteilsanspruchs beträgt drei Jahre ab Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen (§ 1487a Abs. 1 ABGB) § 1487a ABGB.
Unabhängig von der Kenntnis verjähren Pflichtteilsansprüche spätestens 30 Jahre nach dem Tod des Verstorbenen (§ 1487a Abs. 1 ABGB) § 1487a ABGB.
Ein anhängiges Erbrechtsverfahren kann die Verjährungsfrist hemmen. Die Pflichtteilsklage muss jedoch unverzüglich nach Rechtskraft des Beschlusses über das Erbrecht eingebracht werden, um nicht verjährt zu sein (OGH 25.03.2021, 2 Ob 35/21t) OGH 2 Ob 35/21t = Zak 2021/305 (Kolmasch).
Anfechtung letztwilliger Verfügungen:
Das Recht, eine letztwillige Verfügung anzufechten, unterliegt einer dreijährigen Verjährungsfrist ab Kenntnis der maßgebenden Tatsachen (§ 1487a Abs. 1 ABGB) § 1487a ABGB.
Eine absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem Tod des Erblassers gilt unabhängig von der Kenntnis (§ 1487a Abs. 1 ABGB) § 1487a ABGB.
Kinder können unter bestimmten Voraussetzungen enterbt werden, wenn einer der gesetzlich festgelegten Enterbungsgründe vorliegt. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind im österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) geregelt:
Enterbungsgründe gemäß § 770 ABGB:
Ein Kind kann enterbt werden, wenn es gegen den Verstorbenen oder bestimmte nahestehende Personen eine vorsätzliche gerichtlich strafbare Handlung begangen hat, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist § 770 ABGB.
Weitere Gründe sind die absichtliche Vereitelung des letzten Willens des Verstorbenen (§ 540 ABGB), die Zufügung schweren seelischen Leides in verwerflicher Weise oder die gröbliche Vernachlässigung familienrechtlicher Pflichten gegenüber dem Verstorbenen § 770 ABGB, OGH 2 Ob 228/23b = Zak 2024/86 (Kolmasch), OGH 19.11.2024, 2 Ob 101/24b.
Auch eine Verurteilung zu einer lebenslangen oder zwanzigjährigen Freiheitsstrafe wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen stellt einen Enterbungsgrund dar § 770 ABGB.
Enterbung aus guter Absicht gemäß § 771 ABGB:
Wenn ein Pflichtteilsberechtigter aufgrund von Verschuldung oder verschwenderischem Lebensstil Gefahr läuft, dass der Pflichtteil seinen Kindern entgeht, kann der Pflichtteil zugunsten seiner Kinder entzogen werden § 771 ABGB, Nemeth, Enterbung (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Form und Wirksamkeit der Enterbung gemäß § 769 und § 772 ABGB:
Die Enterbung muss durch eine letztwillige Verfügung erfolgen und ein gesetzlich anerkannter Enterbungsgrund muss vorliegen. Sie kann ausdrücklich oder stillschweigend durch Übergehung in der letztwilligen Verfügung erfolgen § 769 ABGB, § 772 ABGB.
Der Enterbungsgrund muss für die Enterbung durch den Verstorbenen ursächlich gewesen sein § 772 ABGB.
Besondere Regelungen gemäß § 775 ABGB:
Wenn der Verstorbene bei Errichtung der letztwilligen Verfügung keine Kenntnis von der Existenz eines pflichtteilsberechtigten Kindes hatte, greift die gesetzliche Vermutung, dass er diesem Kind etwas zukommen lassen wollte § 775 ABGB.
Die Enterbung ist nur wirksam, wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind und der Enterbungsgrund ursächlich für die Enterbung war § 769 ABGB, § 772 ABGB.
Die Erbschaftssteuer in Österreich unterlag den Regelungen des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes (ErbStG). Nach § 1 ErbStG waren Erwerbe von Todes wegen, Schenkungen unter Lebenden und Zweckzuwendungen grundsätzlich steuerpflichtig § 1 ErbStG, VfGH 07.03.2007, G 54/06.
Die Steuerschuld entstand gemäß § 12 Abs. 1 ErbStG bei Erwerben von Todes wegen mit dem Tod des Erblassers. Für den Erwerb unter einer aufschiebenden Bedingung oder Befristung entstand die Steuerschuld mit dem Eintritt der Bedingung oder des Ereignisses § 12 ErbStG.
Die Bewertung des Nachlasses erfolgte gemäß § 18 ErbStG zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld. Die Bewertung richtete sich nach den Vorschriften des ersten Teils des Bewertungsgesetzes VfGH 14.06.1997, B 184/96.
Von dem der Erbschaftssteuer unterliegenden Erwerb konnten gemäß § 20 Abs. 4 Z 3 ErbStG bestimmte Kosten, wie die Kosten der Eröffnung einer letztwilligen Verfügung und die gerichtlichen sowie außergerichtlichen Kosten der Regelung des Nachlasses, abgezogen werden VwGH 23.01.2003, 2002/16/0163.
Es ist zu beachten, dass die Erbschaftssteuer in Österreich durch Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs (BGBl. I Nr. 9/2007 und BGBl. I Nr. 39/2007) aufgehoben wurde und seit dem Jahr 2008 nicht mehr erhoben wird § 1 ErbStG, VfGH 07.03.2007, G 54/06.
Die Kosten für die Nachlassabwicklung werden grundsätzlich aus dem Nachlassvermögen (Nachlassaktiva) getragen. Gemäß § 168 Abs. 3 AußStrG trägt die Verlassenschaft die Kosten der Errichtung eines Inventars § 168 AußStrG. Ebenso sind die Kosten der Verlassenschaftsabhandlung, einschließlich der Nachlasskuratel, aus dem Nachlassvermögen zu begleichen OGH 6Ob535/77 (RS0007668).
Begräbniskosten gehören gemäß § 549 ABGB zu den bevorrechteten Nachlassverbindlichkeiten und sind vorrangig aus den Nachlassaktiva zu bestreiten LStR 2002 - 12.8.8 Begräbniskosten, Begräbniskosten als außergewöhnliche Belastung bei überschuldetem Nachlass? (15.07.2022, LexisNexis Rechtsnews 32806 in lexis360.at). Falls die Nachlassaktiva nicht ausreichen, haften für diese Kosten die zum Unterhalt des Verstorbenen verpflichteten Personen LStR 2002 - 12.8.8 Begräbniskosten.
Darüber hinaus umfasst die Nachlassabwicklung auch die Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Regelung des Nachlasses, der gerichtlichen Sicherung des Nachlasses, der Nachlasspflegschaft sowie der Eröffnung der letztwilligen Verfügung des Erblassers BFG 26.08.2015, RV 7100885/2012.
Die Dauer der Verlassenschaftsabwicklung in Österreich hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Komplexität des Nachlasses, die Anzahl der Erben und die Notwendigkeit von Erbrechtsfeststellungen. Gemäß § 157 AußStrG ist den als Erben in Frage kommenden Personen eine Frist von mindestens vier Wochen zur Abgabe einer Erbantrittserklärung zu setzen. Diese Frist kann aus erheblichen Gründen auf bis zu ein Jahr verlängert werden § 157 AußStrG.
Wenn keine Erbantrittserklärung abgegeben wird, ist ein Verlassenschaftskurator zu bestellen, um das Verfahren vorzubereiten (§ 157 Abs. 4 AußStrG) § 157 AußStrG. In einem dokumentierten Fall dauerte die Abwicklung einer Verlassenschaft drei Jahre, was zeigt, dass die Dauer stark variieren kann BFG 31.07.2017, RV 5101200/2010.
Die Erbauseinandersetzung im österreichischen Recht erfolgt im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens. Die rechtlichen Grundlagen und der Ablauf sind wie folgt:
Erbantrittserklärung:
Der Gerichtskommissär fordert die als Erben infrage kommenden Personen auf, eine Erbantrittserklärung abzugeben (§ 157 AußStrG). Die Form und der Inhalt dieser Erklärung sind in § 159 AußStrG geregelt. Falls widersprechende Erbantrittserklärungen abgegeben werden, bestimmt § 160 AußStrG die weitere Vorgehensweise Deixler-Hübner, Erbantrittserklärung (Stand 26.4.2023, Lexis Briefings in lexis360.at), Nemeth, Aneignungsrecht des Bundes (Stand 18.3.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Feststellung der Erben und ihrer Quoten:
Sobald die Erbantrittserklärungen abgegeben wurden, die Erben und ihre Quoten feststehen und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, wird den Erben die Erbschaft eingeantwortet (§ 819 ABGB). Mit der Einantwortung wird das Eigentum der Erben an unbeweglichen Sachen begründet, das in die öffentlichen Bücher einzutragen ist (§ 436 ABGB) § 819 ABGB.
Auseinandersetzung der Miterben:
Wenn mehrere Erben vorhanden sind, endet das Nachlassverfahren entweder mit einer gerichtlichen Bestätigung der Erbquoten oder mit einer vom Gericht genehmigten Auseinandersetzung der Miterben. Die gerichtliche Genehmigung der Erbauseinandersetzung hat konstitutive Wirkung ex tunc, wodurch jeder Miterbe von Anfang an Eigentümer der ihm zugeteilten Gegenstände wird OGH 28.06.2016, 2 Ob 105/15b.
Die rechtlichen Grundlagen für diese Schritte sind in den genannten Paragraphen des ABGB und AußStrG sowie in der Judikatur des Obersten Gerichtshofs (OGH) verankert. Jeder Schritt ist darauf ausgelegt, die Verlassenschaft ordnungsgemäß abzuwickeln und die Rechte der Erben zu sichern.
Um Erbstreitigkeiten präventiv zu vermeiden, können folgende rechtliche Maßnahmen ergriffen werden:
Testament und Erbvertrag:
Die Errichtung eines Testaments ermöglicht eine klare Regelung der Vermögensnachfolge. Ein Testament kann durch spätere Verfügungen widerrufen oder geändert werden (§§ 713–725 ABGB) ABGB – Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch.
Ein Erbvertrag gemäß § 1252 ABGB erlaubt es, die Vermögensnachfolge verbindlich zu regeln, wobei der Vertragspartner zu Lebzeiten weiterhin frei über sein Vermögen verfügen kann. Rechte aus dem Erbvertrag entstehen erst mit dem Tod eines Vertragsteils § 1252 ABGB.
Pflichtteilsverzicht:
Ein vor Eintritt des Erbfalls erklärter Pflichtteilsverzicht ist ein erbrechtlicher Vertrag, der Streitigkeiten im Nachlassverfahren vorbeugen kann. Dieser Verzicht erhöht die Testierfreiheit des Erblassers und minimiert Konflikte über Schenkungsanrechnungen und deren Bewertung BFG Salzburg RV 6100228/2021 = RdFU 2025/19 (Fraberger).
Rechtswahl bei internationalen Erbfällen:
Nach der EU-Erbrechtsverordnung (VO Nr. 650/2012) kann der Erblasser das Recht seiner Staatsangehörigkeit oder seines letzten gewöhnlichen Aufenthalts als anwendbares Erbrecht wählen. Dies schafft Klarheit und vermeidet Nachlassspaltungen Haberl, Internationaler Erbrechtsfall nach der EU-ErbVO (Stand 08.5.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Vertragliche Regelungen bei Lebensgemeinschaften:
Bei Lebensgemeinschaften empfiehlt sich eine umfassende vertragliche Regelung der Vermögenswerte, insbesondere bei größeren Finanzierungen. Dies kann Streitigkeiten bei der Auflösung der Lebensgemeinschaft und im Erbfall vorbeugen (§ 725 ABGB) Weinrich, Lebensgemeinschaft – Voraussetzungen (Stand 26.2.2025, Lexis Briefings in lexis360.at).
Durch die Anwendung dieser Maßnahmen können potenzielle Konflikte im Erbfall reduziert und die Nachlassregelung effizienter gestaltet werden.
Die rechtlichen Folgen von Schulden des Erblassers für die Erben im österreichischen Recht sind wie folgt geregelt:
Universalsukzession und persönliche Haftung: Mit der Einantwortung tritt der Erbe in die Rechte und Pflichten des Erblassers ein und wird dessen Universalsukzessor. Dies bedeutet, dass der Erbe persönlich für die Schulden des Erblassers haftet, auch wenn die Verlassenschaft nicht ausreicht, um die Forderungen der Gläubiger zu decken. Bis zur Einantwortung haftet jedoch nur der Nachlass als eigenständiges Rechtssubjekt für die Schulden des Erblassers LVwG Niederoesterreich 07.07.2015, AV 459/2015.
Arten von Nachlassverbindlichkeiten:
Erblasserschulden: Dies sind die vererblichen Verbindlichkeiten des Erblassers, die bis zu seinem Tod entstanden sind, auch wenn sie erst später fällig werden VfGH 14.06.1997, B 184/96, BFG 31.03.2017, RV 3100038/2017, VwGH 15.12.2005, 2005/16/0127.
Erbfallsschulden:
Diese entstehen durch den Erbanfall und sind erb- und familienrechtlicher Natur VfGH 14.06.1997, B 184/96.
Erbgangsschulden: Dazu zählen unter anderem die Kosten der Verlassenschaftsabhandlung und Prozesskosten VfGH 14.06.1997, B 184/96, OGH 15.10.1997, 3 Ob 183/97a.
Haftungsbeschränkung bei bedingter Erbantrittserklärung:
Wenn der Erbe eine bedingte Erbantrittserklärung abgibt, ist seine Haftung für die vor dem Tod des Erblassers entstandenen Verbindlichkeiten auf die Summe der übernommenen Aktiva beschränkt. Ohne eine solche Erklärung haftet der Erbe unbeschränkt Lindmayr, Arbeitsrechtliche Folgen beim Tod des Arbeitgebers, ARD 6793/4/2022.
Die rechtlichen Grundlagen für diese Regelungen finden sich insbesondere in den §§ 801 und 802 ABGB sowie in der Rechtsprechung, wie etwa OGH 6Ob6/98w vom 24.09.1998 BFG 31.03.2017, RV 3100038/2017, LVwG Niederoesterreich LVwG-AV-459/001-2015 vom 07.07.2015 LVwG Niederoesterreich 07.07.2015, AV 459/2015, und VfGH B184/96,B324/96 vom 14.06.1997 VfGH 14.06.1997, B 184/96.
Beim Erben von Immobilien in Österreich sind folgende rechtliche Aspekte zu beachten:
Erbschaftserwerb und Verlassenschaftsverfahren:
Der Erwerb einer Erbschaft erfolgt durch die Einantwortung der Verlassenschaft, nachdem das Verlassenschaftsverfahren abgeschlossen ist (§ 797 ABGB, 2017) § 797 ABGB.
Der Erbe muss dem Gericht den Rechtstitel (z. B. Erbvertrag, letztwillige Verfügung oder Gesetz) nachweisen und ausdrücklich erklären, die Erbschaft anzutreten (§ 799 ABGB, 2017) § 799 ABGB.
Verwaltung und Nutzung des Nachlassvermögens:
Nach der Antretung der Erbschaft hat der Erbe das Recht, das Verlassenschaftsvermögen zu nutzen, zu verwalten und zu vertreten, solange das Verlassenschaftsgericht nichts anderes anordnet (§ 810 ABGB, 2017) § 810 ABGB.
Verwaltungs- und Vertretungshandlungen sowie Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehören, bedürfen der Genehmigung des Verlassenschaftsgerichts (§ 810 ABGB, 2017) § 810 ABGB.
Erbantrittserklärung:
Die Abgabe einer unbedingten oder bedingten Erbantrittserklärung sollte sorgfältig geprüft werden, insbesondere bei größeren Vermögenswerten. Die Errichtung eines Inventars oder einer Vermögenserklärung kann erforderlich sein (§ 170 AußStrG, 2005) § 170 AußStrG.
Steuerliche Aspekte:
Die Erbschaftssteuer wird auf den gesamten Vermögensanfall erhoben, wobei bestimmte Kosten wie Bestattungskosten und Pflichtteilsrechte abgezogen werden können (§ 20 ErbStG, 1968) § 20 ErbStG.
Internationale Aspekte:
Bei grenzüberschreitenden Erbschaften gilt das Recht des Staates, in dem der Verstorbene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Dies kann Auswirkungen auf die Anwendung des österreichischen Erbrechts haben, insbesondere bei Auslandsimmobilien Hackl, Arbeitsbuch Herbst 2015 (2015).
Das Erbe regeln, bevor es andere tun.
Niemand denkt gerne über das eigene Ableben nach. Doch ein gut geplantes Testament oder ein durchdachter Erbvertrag verhindert Streitigkeiten, schützt Ihren letzten Willen und kann steuerliche Nachteile vermeiden. Vorsorge im Erbrecht geht allerdings weit über das Testament hinaus: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder auch die frühzeitige Unternehmensnachfolge sind zentrale Elemente.
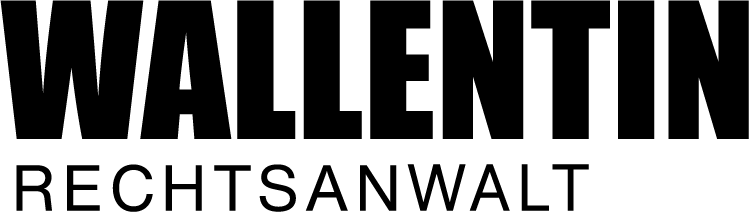


.jpg)